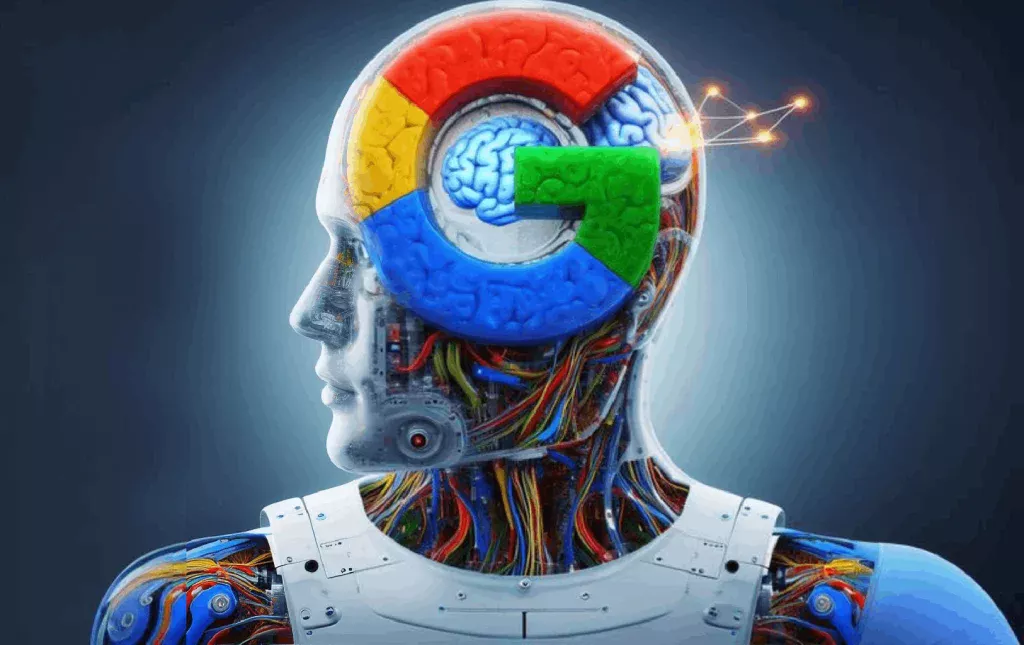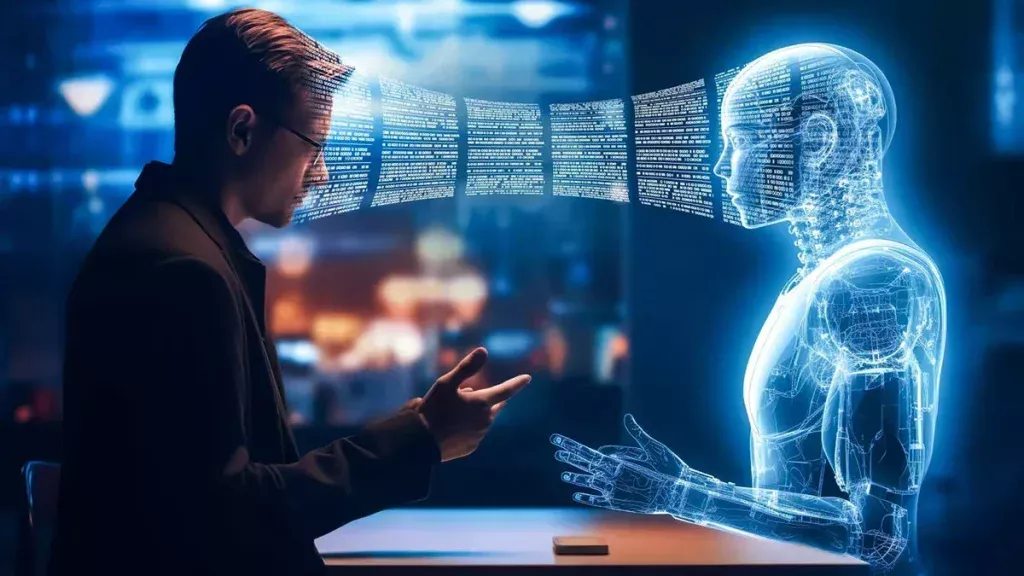Eine japanische Forschergruppe hat modernen Mäusen die DNA eines Neandertalers injiziert und dabei unerwartete Veränderungen im Knochengewebe entdeckt, die Aufschluss über die Evolution des Menschen und die Erhaltung alter Gene in unserem heutigen Organismus geben könnten.
Eine Gruppe von Wissenschaftlern aus Japan hat etwas erreicht, was bis vor kurzem noch Science-Fiction schien: Sie haben ein Stück Neandertaler-DNA in das Genom moderner Mäuse injiziert und die Auswirkungen auf deren körperliche Entwicklung beobachtet. Dieses Experiment, das mit Hilfe modernster Werkzeuge der Genbearbeitung durchgeführt wurde, führte zu anatomischen Veränderungen, die an unsere alten Vorfahren erinnern.
Diese Nachricht sorgte nicht nur wegen der Kühnheit des Vorhabens für Aufsehen, sondern auch, weil sie eine der tiefgreifendsten Fragen der Evolutionsbiologie berührt: Inwieweit leben die Gene unserer ausgestorbenen Vorfahren in uns weiter und wirken in uns? Und was passiert, wenn sie in einem anderen Organismus reaktiviert werden? In diesem Fall kam die Antwort in Form von vergrößerten Schädeln, gekrümmten Rippen und sichtbaren Spuren der menschlichen Vergangenheit in den Körpern der Mäuse.
Eine von den Vorfahren vererbte Mutation
Das Gen GLI3, das im Mittelpunkt dieser Studie steht, ist von grundlegender Bedeutung für die Entwicklung des Skeletts im Embryonalstadium. Die Forscher konzentrierten sich auf eine bestimmte Variante dieses Gens, die als R1537C bezeichnet wird und in der DNA von Neandertalern und Deniswendern vorkommt, aber bei modernen Menschen nicht verbreitet ist. In der Originalveröffentlichung wird erklärt, dass diese Variante „die Regulation von Zielgenen beeinflusst, die mit Entwicklungsprozessen in Verbindung stehen“, ohne jedoch die Stabilität des Proteins oder seine grundlegende Aktivierungsfähigkeit zu verändern.
Mithilfe der CRISPR-Technik hat ein Team der Medizinischen Universität der Präfektur Kyoto Mäuse mit dieser Mutation im Genom erzeugt. Die resultierenden Tiere, die in der Version des Gens Gli3 (entspricht dem menschlichen GLI3) modifiziert wurden, wurden mit einer Knochenstruktur geboren, die der Anatomie von Neandertalern ähnelt: größere Schädel, veränderte Wirbel und gekrümmte Rippen.
Sichtbare Skelettveränderungen bei den modifizierten Mäusen

Die physischen Ergebnisse bei den Mäusen waren eindeutig, messbar und erstaunlich. Bei anatomischen Untersuchungen stellten die Wissenschaftler fest, dass sich bei einigen Exemplaren ein stärker gewölbter Schädel mit vergrößerten Stirn- und Scheitelbeinen entwickelte. Andere zeigten leichte Anzeichen von Skoliose und Brustkorbdeformitäten, wie das Auftreten zusätzlicher Rippen oder verwachsener Wirbel.
Laut der Studie variierten die Auswirkungen je nach genetischem Hintergrund der Mäuse. Beispielsweise wiesen in der C57BL6-Stammlinie 71 % der homozygoten Mäuse mit der Neandertaler-Variante abnorm große Schädel auf, während in einer anderen, vielfältigeren Stammlinie (CD-1) sogar zusätzliche Rippen auftraten, was auch in Neandertaler-Fossilien beschrieben wurde. Die Forschungsgruppe kam zu folgendem Schluss: „Die GLI3-Variante ausgestorbener Hominiden trägt zur Entstehung artspezifischer anatomischer Variationen bei.“
Obwohl diese Mäuse keine schweren Fehlbildungen wie Polydaktylie (zusätzliche Finger) entwickelten, die häufig bei einem Funktionsverlust des GLI3-Gens auftreten, waren die auftretenden Veränderungen konsistent und reproduzierbar. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Mutation R1537C zwar nicht die Funktion des Gens zerstört, aber die Art und Weise verändert, wie er andere Gene reguliert, die für die Entwicklung des Organismus wichtig sind.
Mäuse mit der Mutation Gli3R1540Sfs54X weisen je nach analysierter genetischer Variante Exenzephalie, Polydaktylie und andere Knochenanomalien auf.
Alte Gene, moderne Menschen
Eine der faszinierendsten Entdeckungen ist, dass die Variante R1537C immer noch bei einem kleinen Teil der menschlichen Bevölkerung vorkommt. Laut Daten des Projekts „1000 Genomes“ sind 3,7 % bis 7,7 % der heutigen Europäer Träger dieser Mutation in einer ihrer DNA-Kopien, während ihre Häufigkeit in afrikanischen Populationen viel geringer ist.
Dies eröffnet eine spannende Möglichkeit: Einige moderne körperliche Merkmale, wie bestimmte Formen des Brustkorbs oder Variationen der Wirbelsäule, könnten ihren Ursprung im genetischen Erbe der Neandertaler haben. Obwohl diese Hominiden vor etwa 40.000 Jahren ausgestorben sind, ist ihr Erbe immer noch in unserem Genom vorhanden.
In dem Artikel heißt es: „Mäuse mit der GLI3-Variante des Neandertalers/Denisovaners zeigten Veränderungen in der Skelettmorphologie … was darauf hindeutet, dass die Mutation Entwicklungsprozesse beeinflussen könnte, die bei Mäusen und Menschen erhalten geblieben sind.”
Adaptiver Vorteil oder nur ein evolutionärer Zufall?

Obwohl die Forscher nicht behaupten, dass die Variante R1537C eindeutig negative Auswirkungen hat, weisen sie darauf hin, dass einige davon vom genetischen Kontext abhängen können, in dem sie auftritt. Mit anderen Worten: Die Mutation wirkt nicht für sich allein: Ihre Auswirkungen können je nach dem Rest des Genoms verstärkt oder abgeschwächt werden.
In diesem Sinne könnte die menschliche Evolution solche Varianten aufgrund des geringeren Selektionsdrucks erhalten haben, wie in dem Artikel vermutet wird: „Die Mutation wurde durch die Lockerung der Entwicklungsbeschränkungen im Laufe der menschlichen Evolution ermöglicht.“
So ist es möglich, dass der Körperbau der Neandertaler – mit ihrem kräftigen Skelett, der breiten Brust und dem länglichen Schädel – nicht nur durch die Umgebung, in der sie lebten, bedingt war, sondern auch dadurch, wie bestimmte Mutationen wie diese mit dem Rest des Genoms und der Embryonalentwicklung interagierten.
Was sagt das über uns aus?
Abgesehen von der genetischen Neugierde ermöglicht dieses Experiment ein besseres Verständnis dafür, wie selbst kleine Mutationen die Form des menschlichen Körpers beeinflussen können. Es bekräftigt auch die Vorstellung, dass alte DNA nicht nur ein Relikt der Vergangenheit ist, sondern ein Werkzeug, um die Evolution in Echtzeit zu untersuchen.
Darüber hinaus wirft es neue Fragen zu unserer eigenen Biologie auf: Können bestimmte Knochenkrankheiten, Wirbelsäulendeformitäten oder körperliche Unterschiede durch Gene verursacht sein, die wir von ausgestorbenen Hominiden geerbt haben? Obwohl es noch keine endgültige Antwort gibt, lässt die Studie die Möglichkeit offen, zu untersuchen, wie Varianten wie R1537C mit unserer Umwelt und anderen Mutationen interagieren.
Die Studie eröffnet auch einen neuen, vielversprechenden Ansatz in der Evolutionsbiologie: nicht nur alte DNA zu lesen, sondern sie an lebenden Organismen zu testen, um ihre Auswirkungen zu beobachten. Diese Technik könnte, sofern sie vorsichtig und ethisch einwandfrei angewendet wird, unser Verständnis der menschlichen Evolution völlig verändern.